Ihr wollt ein Klischee kommentieren? Das geht im > Wartezimmer
0531

Meine Maifreiheit
12 Besuche in der Bar 33
8 Wiener Frühstücke mit 2 Kaffee inklusive
31 Besuche in der Klischeeanstalt
3 Einträge über die Justizanstalt
21 Weisse Spritzer
2 Entschuldigungen, eine gemacht, eine erhalten
64 Seiten Notizen
7 Geschenke, eins gemacht, fünf erhalten
4 Überraschungen
320 Fotos, 25 von der Justizanstalt
19 Wiedersehen
1 Entscheidung
4 Smaragdeidechsen
1 Mutkauf
4 Semmelknödeln
1 Besuch in der Justizanstalt
1 Lesung in Wien
5 Postkarten
1 Brief
1 erstes Mal
3 Fluchtachterl
1 Erkenntnis
3 Besuche, einer verpasst
7 neue Menschen
1 neues Ende
0530

Ich habe von den Tagen mit und ohne Bedeutung geschrieben, davon, was ihnen anhängt, was sie beschwert oder beleuchtet. Ich habe von den Tagen mit Signalwirkung geschrieben. Der 30. Mai ist so ein Tag. Und das hat mit einem Lied zu tun. Dem 30. Mai hängt ein Lied an und mit dem Lied eine Mischung aus Endzeitbewusstsein und Weinseligkeit. Seit ich ein Kind war, habe ich es gehört, habe ich diese Nachricht empfangen: Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang. Wir leben nicht mehr lang. Ein Lied aus den frühen 50ern, gar nicht so lang nach Davon geht die Welt geht nicht unter, und wenn sie nicht einmal davon untergegangen war, konnte man ja weiter trinken.
Und es hatte wohl eine konkrete Prophezeiung gegeben, eine von vielen, aber auf diese für den 30. Mai hat sich das Gorlowski-Quartett einen Reim gemacht, mit der nur scheinbar erlösenden Pointe: Doch keiner weiss in welchem Jahr / und das ist wunderbar. Und diese Pointe hat nun den 30. Mai für immer mit dem Untergang verbunden. Man kann nicht, wie am Morgen nach der Mottoparty zum Mayauntergang die Hände reiben und sagen: Ich hab es sowieso nie geglaubt. Es gibt immer einen nächsten 30. Mai. Der Termin wird nie abgesagt, nur verschoben. Schon der nächste 30. Mai könnte es sein. Heute zum Beispiel.
Ich weiss nicht, ob ich das als Kind schon begriffen habe. Oder ob ich es mit Siebzehn, unmittelbar nach Tschernobyl, nach I hope the Russians love their children too und Besuchen sie Europa, solange es noch steht, tröstlich fand, als sich die Toten Hosen beim Anti-WAAhnsinns-Festival gegen die Wiederaufarbeitungsanlage von Wackersdorf mit ihrem 30.-Mai-Cover auf einen Termin festgelegt haben: Doch jeder weiss: nur noch ein Jahr / und das ist wunderbar.
Ob ich es tröstlich fand, dass die Welt im Jahr darauf wieder nicht untergegangen ist. Eher nicht, denke ich. Denn ich habe auch danach nie einen Sinn fürs Langfristige gehabt. Und ich plane immer noch nicht gern über den nächsten 30. Mai hinaus.
0529

Zeichen
Wieder einmal aus den Umrissen der Berge Bedeutung lesen, Buchstaben aus den unbewaldeten Flächen, wieder einmal Wolkennachrichten empfangen, Astlöcher zählen – auf die Länge der Planke elf – und
die Seesonnenblitze für Kurzwellen halten, wieder mal glauben, der Vierte, der durch die Tür kommt, der ist es, der bringt eine Botschaft, eine gute oder zumindest eine für mich.
Zwischen drei Bergen das W sehen – keine Kunst, aber erkennen muss man es doch – und der Optimist bewegt seinen Mast metronomisch, der Sonnenkogel sieht aus wie ein Wisent und der Wind auf dem
See, als könne man mit den Fingerkuppen darüber fahren, mit geschlossenen Augen, wie über eine Walnussschale.
Und einer hält eine Zigarette parallel zum Wasserspiegel, ein Ärmel weht in der Luft, ein gestreifter, dahinter hebt jemand die Hand, wie zum Winken, was nichts bedeutet, während in der Mitte der
Wolke ein Stern ausreißt, wieder mal eine Nachricht erhalten, von einem Schatten, dem Lichteinfall, einem Torso oder der Abwesenheit von Nebel.
0528

0527

Heute lese ich auf der Liechtensteinstrasse, wenige Häuser entfernt von meiner ersten Wiener Wohnung, gestern war ich beim Lyrik-Fest der Alten Schmiede, fühlte mich zurückversetzt in die Zeit, als ich an der schule für dichtung Klassen bei Christine Huber und Christian Loidl besuchte, als ich hier lebte und Gedichte in Lokalen schrieb. Eine ganze Lokalserie hat es gegeben. Zwei daraus, aus dem letzten Jahrtausend, jetzt also hier in der Klischeeanstalt:
lokal 7
infinite mittagspause
beküssungen im spiegelbild
wir kennen uns
wir baden in der selben enge.
und tageweise geht ein andres klingeln
durch die aufgeschäumte milch
wir treffen die entscheidungen aus der bewegung
besetzungslisten werden für die bar gemacht.
es lächelt sich so gut hinweg
über die köpfe
die mäntel bleiben lässig stehn
das brot wird immer pappiger
in richtung süden
zum graben ist es nicht mehr weit.
wir kennen uns
wer keinen kennt, ist nicht von hier
und hat sich auf dem weg zum stephansdom verlaufen.
zwischen den transaktionen geht sich sicher noch
ein achtel aus.
lokal 12
alles wieder im lot.
vertrautes tellergestapel
ich besser allein das unter vielen
ellenbogen auf platte
ort zum bebleischreiben
ich ohne dies andere
mein bleiblick fraglich
ich in der tinte. wieder
stirn tragend
nachtragend
suchend nach vor bei
hält hof straße weiter
fällt zusammen
ort zeit
ist hof zu
bleibt hoffen offen
wird zeitraum
zu fällig
trifft ort nicht mehr punkt
verfällt einsatz
und überschreibt
alles besprochen
wird handlung buch
0526

Als Kind hat sie die Häuser der Weinbergschnecken angemalt, um sie vor den Haubenköchen zu retten. Neongelbe Schnecken lassen sich nicht verkaufen, hat sie gedacht. Jetzt sprüht sie auf abbröckelnden Putz, verschönert die alten Häuser hinter dem Bahnhof, hat immer eine zweite Dose Neongelb in der Tasche.
0525

Die Segler. Die tanzen am Himmel. Zusammen. Bei Trakl. Des Vogelfluges wirre Zeichen lesen. Mauern sind keine da. Für die Segler. Vielleicht sind es Schwalben. Die tanzen für mich. Dem Sperber was vor. Dem Falken. Als spielten sie fangen. Aber wer wird gejagt? Ich hab das noch nie gesehen. Das seh ich zum ersten Mal. So einen Greifvogel. Über der Stadt. So einen Schwarm. Dieses Kreisen und Tanzen.
(Aus: Hinter den Augen, Luftschacht Verlag, 2013)

0524

Wenn ich mit der Hand schreibe, in mein Notizbuch schreibe, beginne ich immer mit dem Datum, vor jedem Eintrag, auch vor dem zweiten oder dritten des Tages, steht ein Datum. In der letzten Zeit ist mir aufgefallen, dass fast jedes Datum eine Bedeutung hat. Geburtstage von Menschen, die ich kenne oder gekannt habe, selbst wenn ich ihnen nicht gratuliere, der Tag ist mit ihnen verbunden, ich denke an sie. Die vom Mond unabhängigen Feiertage, der 1. Mai, der 1. August, der 24. Dezember, auch am 17. Juni und am 3. Oktober erinnere ich mich kurz daran, dass in Deutschland gefeiert wurde oder wird. Und dann natürlich die Signaltage, der 6. August, der 11. September, der 8. Mai, leider auch der 20. April, wie kann es sein, dass noch immer der 20. April in meinem ewigen Kalender steht, jedes Mal geht ein kurzer Ruck durch den Tag. Aber dann auch wieder die Tage mit den schönen Erinnerungen. Der 22. November bleibt der Tag meiner ersten Lesung, im damals noch so lebendigen Buch und Wein in Wien, Gert Jonke, dessen Tag der 8. Februar ist, sprach über Vögel. Natürlich der 6. Januar, nicht wegen der drei Könige, der 6. Januar oder der 7. Januar, weil Mitternacht vorüber war, als wir es wussten. Manche Tage sind überfüllt, vier deutsche Wendepunkte am 9. November, vier Geburtstage am 3. Februar, und als ich vor einigen Wochen gefragt wurde, ob mir der 27. Mai für die Lesung in der Buchhandlung Orlando in Wien passe, dachte ich erst: Nein, da war doch was. Bis mir einfiel, dass meine letzte Lesung in Wien auch an einem 27. Mai stattgefunden hat. Es gibt nur noch so wenige leere Tage. Es gibt immer weniger Tage ohne Bedeutung. Heute ist einer.
0523

Obwohl ich durch Fragen und Beobachten versuche, hinter die Geheimnisse von Krems zu kommen, gibt es Dinge, die sich mir nicht erschliessen. Da sind zum Beispiel die Schiffsanlegestellen, die eigentlich Donaustationen heissen. Wenn ich morgens dort vorbeilaufe, komme ich zuerst an der 25 vorbei, dann an der 24, dann an der 23 und schliesslich an der 33 (ich laufe flussaufwärts und immer schön geradeaus). Zuerst dachte ich, dass derjenige, der das letzte Schild gemalt hat, Stammgast in der Bar 33 wäre. Aber die Erklärung von H., der mich aus Wien besucht hat, erschien mir dann mindestens genauso überzeugend. Er meinte, der Maler des Schildes habe aus Versehen nochmals eine 23 gemalt, dann habe ihm einer zugerufen: Geh bitte, was ist denn mit der 3? Woraufhin der andere die 2 ganz pflichtbewusst mit einer 3 übermalt habe. Danach hat er natürlich Feierabend gemacht und ist in die Bar 33 gegangen. Der Mann im Pensionsalter, der morgens immer, wenn ich am Ende des Donauweges eine Schleife laufe, unter demselben Baum im Auto sitzt und so tut, als würde er Zeitung lesen, hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Er hat auch die Donaustation nicht im Blick. Ich halte ihn für einen Privatdetektiv oder professionellen Brückenbeobachter. Vielleicht ist er Teil einer grösseren Überwachungsaktion, denn in den Weinbergen bin ich auf einen Pilz aus Metall gestossen, der vermutlich ein Aufnahmegerät beherbergt. Bevor ich ihn berührt hatte, dachte ich noch, ich hätte einen Grauen Wulstling oder einen Blaugrauen Scheintrichterling gefunden. Wie Kunst sieht er jedenfalls nicht aus. Für sachdienliche Hinweise in der einen oder anderen Causa wäre ich dankbar.

0522

Vorgestern oben auf dem Rebberg, hinter mir Jesus, Nägel in den Füssen, Stacheldraht um den Kopf, die Augen
geschlossen. Schaut nicht hinunter wie ich, auf die Justizanstalt,sieht nicht, wie dort Insassen
Fussball auf Rasen spielen, wie sie laufen, passen und Tore schiessen, hängt am Kreuz neben den Reben, die Augen geschlossen. Von unten her Schreie, vom Rasen inmitten von Stacheldrahtrollen,
Schreie von Männern, die Fussball spielen. Im Hof daneben gehen welche spazieren, im Kreis, Rasen wie drüben, unterbrochen von Wegen, in Kreisen und Kreuzen. An Versailles denk ich, und was denn
der Mann macht, der vom Dach runtersteigt. Bricht der aus? Aber es ist nur ein Maler, der die Fassade streicht.

0521

Wenn ich an einen einzigen Punkt in die Vergangenheit reisen dürfte. Wenn das möglich wäre. Ein weitläufiger Flashback. Dann würde ich in unsere Wohnung zurückgehen. An einem Sonntag. Im Vorschulzeitalter. Ein Tag, an dem wir zu dritt auf dem Balkon sitzen. Und es gibt Quarkspeise mit Erdbeeren und ich mache rote und rosafarbene Spiralen mit dem Löffel. Und die Erdbeeren sind süss und aus der Umgebung. Und mein Vater hustet nur wenig, zeigt mir im Ahornbaum eine Elster. Dass sie Nesträuber sind, sagt er, während meine Mutter den grossen Löffel ableckt, mit der Wölbung nach aussen. Ihn in die Sonne hält, dass er Lichter an die Balkondecke wirft. Und auch mich einen Augenblick blendet. Und sie sagt, dass die Elstern auch Löffel klauen. Dass sie es selbst erlebt habe, als Kind. So einen kleinen silbernen Teelöffel, vom Gartentisch. Was machen denn Elstern mit Löffeln? Und ich stelle mich auf den Stuhl, trage einen kleinen Löffel auf den flach nach oben geöffneten Händen, um den Mund einen hellrosa Quarkbart. Und mein Vater nimmt mich hoch, auf den Arm, hält mich fest, so dass ich beide Hände über die Brüstung strecken kann, während meine Mutter in die Küche geht, um Alufolie zu holen. Und ruft, dass der Löffel ein Erbstück sei, aus seiner Familie. Und dann tauscht sie die Folie gegen den Löffel, aber die Elster, genauso schwarz-weiss wie meine Mutter in ihrem Etuikleid, fliegt hoch, über den Wipfel des Ahorns und ist nicht mehr zu sehen. Mein Vater atmet schwer, aber lacht. Und er legt die Folie auf die Brüstung, beschwert sie mit einer Erdbeere. Bestimmt ist sie weg, wenn wir wieder zurück sind. Denn wir gehen jetzt in den Park, gehen zum Entenweiher und lassen ein kleines Segelboot ins Wasser, an einer Kordel, damit es nicht abtreibt. Mein Vater und ich, wir hocken im Gras, meine Mutter steht in dem schönen Kleid auf einem Stein, um die Schuhe zu schonen. Und sie singt das Lied vom Schiff. Das wird kommen. Und wenn sie den ich so lieb wie keinen singt, schaut sie meinen Vater an. Und als ich das Boot durchs Wasser ziehe, ein paar neugierige Teichhühner versuchen es kentern zu lassen, umarmen sich meine Eltern im Park. Am Sonntag. Es ist Juni. Ich bin fünf. Und mein Vater hat einen guten Tag. Meine Mutter singt. Wir sind eine Familie. Ich möchte in dieses Gefühl zurück. Es gab viele solcher Tage. Feiertage. Wochenenden. Ferien. Es gab sie. Es gab sie oft. Ich möchte mit dir an einen Ort, den wir beide nicht kennen, wo Gerüche sind, die wir beide nicht kennen. Gerüche, Geräusche und Farben. Ich möchte mit dir für möglich halten, was wir beide nicht für möglich gehalten haben. Zuvor.
(Aus: Hinter den Augen, Luftschacht Verlag, 2013)
0520

Davanti alla casa del cinema
So stehen sie beide. Auttuno. Inverno.
Auch jetzt noch im Frühling der fehlenden Blüten.
Der Projektor. Die Leinwand. Senza parole.
Dazwischen die flirrende Leere des Wartens.
Alla unica presentazione dell‘anno.
Er wäre gern sie.
Sie wäre gern beide.
Oppure la luce.
P.S.: Ich hatte vorgestern Pasolini vergessen. Der auch zu den radikalen Freigeistern im Internet gehört.
Dafür poste ich jetzt den Link zu dem von ihm selbst gelesenen Gedicht „Io sono una forza del passato“.
0519


0518

Die meisten Autor_innen veröffentlichen auf ihren Websites ausschliesslich gute Rezensionen oder gute Passagen aus erträglichen Rezensionen (mir fällt als Gegenbeispiel nur Franz Hohler ein, der stolz seine liebsten Verrisse präsentiert, aber für den gilt wahrscheinlich inzwischen, was die Counting Crows von Bob Dylan singen: When everybody loves you, son, that's just about as funky as you can be.)
Andererseits gibt es Autor_innen, die veröffentlichen überhaupt keine so genannten Stimmen zu ihren Büchern, die halten nichts von Rezensionen und lesen sie auch nicht, nicht mal welche, die sich mit Büchern von anderen Leuten befassen.
Ich habe bislang zu den Lieblingskritikenveröffentlicherinnen gehört, komplette Kritiken zuerst, später dann nur noch eine Best-of-Seite pro Buch. Ich habe nicht zu denen gehört, die Kritiken links liegen lassen, abgesehen von ein oder zweien, die ich auf Anraten meines Verlegers oder einer anderen um meinen Seelenfrieden besorgten Person nicht (oder erst mit grossem zeitlichem Abstand) gelesen habe.
Ich bin auch nicht eine von denen, die lesen und vergessen. Insbesondere die schlechten Kritiken, die schlechten Passagen aus den erträglichen Kritiken besetzen hartnäckig Speicherplatz in meinem Gedächtnis, einzelne Sätze daraus poppen in den unpassendsten Momenten auf wie Werbefenster für Sportwetten.
Einer von diesen Sätzen hat sich als besonders penetrant erwiesen, hat stets alle Pop-up-Blocker überwunden, dieser Satz, der mich übrigens in Österreich ereilt hat, geht mir mehr als andere nach und nah. Das könnte an seiner Prägnanz liegen, war es doch der Schlusssatz einer kurzen Kritik, wahrscheinlicher aber daran, dass er so viel mit mir zu tun hat.
Und wenn ich auch weit entfernt von Hohlerscher Funkyness bin, will ich doch meine Zeit in der Klischeeanstalt nutzen, um diesem Satz eine Plattform zu bieten:
Freigeistigkeit sieht anders aus.
So, da steht er. Und ich denke, solange ich mich noch frage, wie sie denn nun aussieht, die Freigeistigkeit, solange ich mich noch frage, was es mit mir und der Radikalität auf sich hat, solange ich noch nach radikalen Freigeistern bei Google suche, (Cyrano de Bergerac, John Cusack, Philippe Petit und, aber abwertend, Lady Gaga), solange an meiner Lampe noch die Tüte mit den Sprüchen von Jenny Holzer hängt (Abuse of power comes as no surprise, Money creates taste, The future is stupid...), solange ich noch Kritiken lese und mir darüber Gedanken mache, soll er getrost hier stehen, vielleicht schreibe ich ihn sogar demnächst auf die Holzersche Tüte.
0517

Der Hund ist tot
Der, der den Hund begraben hat, der hat vergessen, wo er liegt. Der hat kein Kreuz gemacht und keine Kerbe. Der hat von Breitengraden keine Ahnung und weiß nicht mal, in welcher Gegend. Ob er den
Hund in halbgefrorner Erde, in abgesacktem Sand, in Torf, in Lehm. Er weiß es nicht.
Jetzt suchen alle nach der Leiche. Mit Wünschelruten, Satelliten, Schäferhunden. Mit Archäologen, Pathologen, Kopfgeldjägern, Agenten, Agenturen und Experten. Mit Bodentruppen und mit
Religion.
Der, der den Hund begraben hat, der hat den Hund nicht mal gekannt. Er hat ihn bloß gefunden. Der, der den Hund begraben hat, der fürchtet sich vor Hunden, selbst vor toten. Er hat so tief
gegraben, wie er konnte. Ob er vor Jahren, Tagen, vor Jahrzehnten. Er weiß es nicht. Er weiß auch nichts vom Leichengift.
Weil niemand wirklich weiß, wo er begraben liegt, gibt es an jeder Ecke Hundegräber, und jeder hält ein andres Grab für das verbürgte. Sie weinen Tränen über Maulwurfshügel, sie klagen, schreien,
werfen Blumen, sich zu Boden, einander vor, am falschen Grab zu stehn und sagen: Das Grab ist leer.
Der, der den Hund begraben hat, der leidet lang schon unter Amnesie. Seit er am Grab des ungekannten Hundes stand. Er weiß nicht, wer er ist noch was er wollte. Er wird von niemandem erkannt. Er
ist mit niemandem verwandt. Doch jeder fragt ihn nach dem Weg. Er weiß ihn nicht.
0516

0515

Totale Phase
Wir gehen den Mond unter der Brücke suchen. Viel haben wir noch nicht gemeinsam. Nur die Zukunft und eine Verabredung zum Mond. Du kannst mit ihm tanzen. Ich seh dir zu, an den Pfeiler gelehnt. Der Mond spiegelt sich in der Schneedecke, sage ich und du nimmst mir nicht übel, dass ich ohne Not lüge. Hinter meinem Rücken steigt der Mond in den Fluss. Ich kann dein Lied sehen.
Ich tanze so gern mit dir im Schnee, werde ich Wochen später sagen. Du wirst mir Lieder schenken, damit ich sie trage. Zwischen uns fallen flach die Kristalle. Du darfst mich vertonen, werde ich sagen, obwohl du so viel Entfernung brauchst und ich so viel Rot.
Wie lange noch, frage ich, als du mich in den Kreis holst. Wir haben noch nie eine Uhr gehabt. Nicht mal am Anfang. Wir raten. Wir laufen. Wir tanzen. Manchmal sind wir uns Mond. Der lacht hinter halb vorgehaltener Hand. Es ist so weit, sagst du, und wir tanzen den Kopf im Nacken. Bis wir unter der Brücke stehen. Über meinen Kopf hinweg siehst du, wie der Mond in Deckung geht, mein Rücken warm.
So werden wir oft stehen, der Größe nach. Ich werde sagen: genau hier. Wochen später wirst du die Schneeflocken aufs Sterben vorbereiten, bevor ich sie trinke. Wie kann es nicht dunkel werden. Es ist eine gute Zeit zum Schmelzen. Ich denke an dich in Temperaturen. In Gegensätzen. Das Licht ist kalt, das Wasser warm. Monde später werden wir uns anvertrauen. Ich kann dein Lied sehen, wirst du sagen. Ich tanze dazu. Schön, wirst du sagen. Ich küsse dich auf die Augen. Schön, dass der Spiegel schmilzt.
Totale Phase im Literaturradio.at
Aufnahme: TITTANIC beim Zürcher Theater Spektakel 2008
Stimme: Ulrike Ulrich
0514

0513

Tumbleweed
Weil ich eigentlich gar nicht da sein sollte. Aber natürlich haben wir uns gefreut. Und deine Geschwister hättest du sehen sollen. Habe ich doch. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, geschrien, mit den Fäusten getrommelt. Da haben sie mich ausgesetzt. Zwischen die Löwenzähne. Ich war noch so klein, viel kleiner als alle anderen. Du wächst ja noch, haben sie gesagt. Du wächst ja noch über die Löwenzähne hinaus, über die Pusteblumen. Aber die Fallschirme sind mir um die Ohren geflogen, bei jedem Windstoss prasselten sie mir gegen die Stirn. Noch bevor sich die Fontanelle schloss, sass ich im tiefen Gras neben dem Springbrunnen und hatte keinen Namen. Ohne Namen sass ich im tiefen Gras und wehrte mich mit Händen und Füssen. Käfer krabbelten über meine Zehen. Ameisen trugen sich gegenseitig meinen Arm herauf. Was hat denn das Kind? Es ist so nervös. So nervös ist das Kind, wo es doch in der Idylle sitzt. Und die Gräser. Hörst du nicht? Die singen dem Kind. Ein Schlaflied. Gänseblümchen mein Engelchen, fall nicht vom Stängelchen. Alle Blüten geschlossen, im Osten schon dunkel, nur das Kind sitzt noch im tiefen Gras und trommelt sich eine Lichtung.
Wie sollen wir es rufen, wenn es keinen Namen hat? Ausgesetzt haben sie mich. Dem Wind und den Tropfen, die vom Springbrunnen herüberwehen. Du wächst ja noch, haben sie gesagt. Sie sind gross wie Zaunpfähle. Sie stehen nebeneinander und winken. Aber ich komme nicht. Solange nicht, bis sie das Kind beim Namen nennen. Solange bleibe ich hier draussen sitzen und trommle ein Erdbeben, dass keine Ameise und kein Pusteblumenfallschirm an seinem Platz bleibt. Und wenn es ein Mädchen wird. Dann können wir immer noch überlegen. Das Kind ist in der Wildnis aufgewachsen. Wir haben vom Balkon aus betrachtet, wie es erst den Gänseblümchen über den Kopf wuchs, dann den Löwenzähnen und schließlich konnte es über den Zaun schauen. Das Kind wächst wie Unkraut, riefen die Nachbarn vom Balkon, aber wir verbaten ihnen den Mund. Als es ausgewachsen war, löste es sich und trieb mit dem Wind davon.
0512
Anderthalb Jahre bis lebenslänglich. Also die ganz harten Fälle. Sagt wer. Dear Artist. Filming and Photographing. All die Fritzls. Sagt wer. Of the prison is strictly forbidden. Ikonenmalgruppe. Und Kellnerausbildung. Dear Artist. It’s the main topic. On our floor. Has always been. Nimmt ja keiner den Pass mit zum Banküberfall. Und die Botschaften stellen sich dumm. Wollen die Leute nicht kennen. Da weiss keiner genau, wo die herkommen, welche Sprache die sprechen. Sagt wer. Ganz schwere Jungs. 700 sitzen da drin. Oder mehr. Alles Männer. One of them tried to communicate. With someone from 24. One of them held signs up. Dear Artist. But she didn’t answer. Sagt wer. She never answered. Ich bin ja hier schon als Kind durchgelaufen. War ganz normal. Links das Gefängnis. Und gegenüber die Teppichfabrik. Das war ja hier eine Teppichfabrik. Sagt wer. Wo ihr jetzt untergebracht seid. Dear Artist. Tapeziererausbildung. Lehrabschlussprüfung. Tischtennisgruppe. And there was this woman. Who couldn’t stand it. You know. It just freaked her out. To live right across from the prison. Sagt wer. She turned on her heel. West E heisst er. Der Hochsicherheitstrakt. All die Fritzls. Wast eh. Unter Strassenniveau. In der Stadt ignoriert man sie lieber. Die Justizanstalt Stein. Da spricht man nicht drüber. Is strictly forbidden. Auch die Kunstmeile kaum. Sagt wer. Nutzt aber die Mauer. Die Aussenmauer für Werbung. Krimi Krems steht da jetzt. Kottan ermittelt. Knatterton kombiniert. Das ist ja gar nichts. Sagt wer. Vor kurzem standen da Panzerknacker. Pappkameraden. Grad gegenüber. Grinsten gestreift in die Anstalt hinein. Sicher. Es ist schon wer ausgebrochen. Aber die kriegen sie meistens. Sagt wer. Und wenn nicht. Die bleiben ja nicht in der Gegend. Einen gabs auch, tragischer Fall, der wollte nicht raus, als er durfte. Langzeitbesucherraum. Massnahmenabteilung. Und einer von euch. Sagt wer. Der hat mal einen sehr starken Zoom benutzt. Dear Artist. Die Männer in ihren Zellen gefilmt. Und seitdem. Ist ja kein Wunder. Sagt wer. Strictly forbidden.
0511

Als ich vor einer knappen Woche hier ankam, dachte ich erst, das sei ein Kloster. Der vordere, der 175 Jahre alte Teil war mal ein Kloster, in das zumindest einige der Redemptoristinnen freiwillig eingetreten sind. Unfreiwillig haben sie es verlassen, wurden daraus vertrieben, als die Strafanstalt Stein gegründet wurde.
Wenn ich aus der Tür der ehemaligen Teppichfabrik trete, in deren oberstem Stock sich die Artist-in-Residence-Ateliers befinden, stehe ich vor Österreichs grösster Strafvollzugsanstalt. Wäre ich nicht Schriftstellerin, wäre ich beispielsweise Architektin oder Musikerin, dann würde ich nicht auf die Donau schauen, wenn ich morgens aufwache, sondern direkt in die grösste Strafvollzugsanstalt Österreichs.
Zwischen mir und der Bar 33 liegt das Gefängnis, zwischen mir und dem Café, wo es zum Frühstück den zweiten Kaffee gratis dazu gibt, liegt das Gefängnis. Zwischen mir und dem Weinberg, mir und dem Kino, mir und dem Museum liegt das Gefängnis.
Auf dem Weg, der zum Café führt, läuft eine Eidechse vor mir her, gross und grün, nicht klein und braun wie die Echsen, die ich aus Zürich kenne. Eine Smaragdeidechse läuft vor mir her, läuft mir nervös davon, der Gefängnismauer entlang. Sie sucht nach einem Ort, um sich zu verstecken, sie sucht nach einem Loch am Boden, einer Ritze in der Gefängnismauer, aber da ist nur Beton oder Asphalt, letzterer an manchen Stellen von Kippen und Taubenkot bedeckt. Nach zwanzig, dreissig Metern macht sie plötzlich Halt und lässt mich vorbeigehen, wartet einfach, bis ich vorbeigegangen bin, ein ganzes Stück voraus bin, dann setzt sie ihren Weg entlang der Gefängnismauer langsam und gleichmässig fort. Ich mache das auch so, wenn jemand nah hinter mir geht, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand mir hinterhergeht.
0510
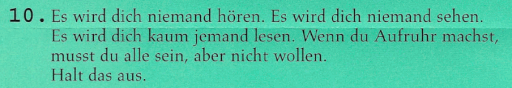
Irgendwann, wenn ich über Radikalität nachdenke, würde Marlene Streeruwitz vorkommen. Irgendwann, wenn ich 31 Cartes Blanches habe, würde Marlene Streeruwitz vorkommen.
Nr. 10 stammt aus ihrer Theorie der Romane in drei Mal 0 plus 13 Punkten.
0509

0508
Solang ma no
Solang ma no hatschn kennan1, sagt der grosse alte Mann an der Bar, dessen Teleskopstöcke neben ihm an der Wand lehnen, zu der Frau im orangenen Kleid, die schon eine Weile
mit einer Melange da sass, bevor er kam. Solang ma no aussi kumman2, antwortet die Frau, die vielleicht zehn Jahre jünger ist als er, solang ma no do sitzn
kennan3.
Ich sitz da, mit dem Rücken zu den beiden, trink wieder Spritzer für 1,70 und frag mich, wie einmal meine „Solange wir noch“-Sätze zu Ende gehen werden. Und ob ich nicht jetzt schon beginnen
sollte damit. Da hör ich den alten Mann sagen: Wos wü i no? I brauch jo nix.4
Das ist doch radikal, denk ich. Nichts brauchen. Nichts erwarten. Das wäre doch radikal. Und auch: keine Erwartungen erfüllen.
1 Solange wir noch (schwerfällig) gehen können.
2 Solange wir noch raus kommen.
3 Solange wir noch da sitzen können.
4 Was will ich noch? Ich brauch ja nichts.
Radikal (v. lat.: radix ‚Wurzel‘, ‚Ursprung‘) bezeichnet1:
- das Ergebnis des Wurzelziehens, siehe Wurzel (Mathematik)
- verschiedene algebraische Konstruktionen, siehe Radikal (Mathematik)
- in der Chemie freies Radikal, siehe Radikale (Chemie)
- veraltet eine funktionelle Gruppe
- historische Bedeutung in der Chemie, siehe Radikaltheorie
- in der Phonetik einen Laut, der mit der Zungenwurzel gebildet wird, siehe Radikal (Phonetik)
- in der Sinologie einen Teil eines chinesischen Schriftzeichens, siehe Radikal (chinesische Schrift)
- in der Semitistik einen der Konsonanten der Wurzel eines Wortes, siehe Radikal (semitische Sprachen)
- in der Soziologie eine Eigenschaft des Wandels, siehe Sozialer Wandel
- eine – oft abwertend gebrauchte – Bezeichnung verschiedener politischer Strömungen, siehe Radikalismus
- eine politische Einstellung im 19. und frühen 20. Jahrhundert, siehe Liberalismus
1 Quelle: Wikipedia
0507
0506
Soletti
Ich wohne im TOP 22. Das ist ein schönes Atelier mit spektakulärer Aussicht auf die Donau. Aber kaum hab ich die Tür hinter mir geschlossen, kaum hab ich den Koffer ausgepackt und den Rechner samt Internetanschluss in Betrieb gesetzt, will ich schon wieder raus. Nicht nur, weil ich nichts als Wein, Gurken und Marillenmarmelade im Kühlschrank habe. Auch weil abruptes Alleinsein mich lähmt.
Also gehe ich in die Bar 33. Das weiss ich natürlich noch nicht, als ich losgehe. Ich kenne hier kein Café, keine Bar, kein Restaurant, nicht in Krems und erst recht nicht in Stein, dem Stadtteil von Krems, in dem ich wohne. Stein ist alt. Stein ist still. Stein blättert ab. In Stein hängen die Leute allein oder zu zweit aus Erdgeschossfenstern und grüssen zurück.
In der Bar 33 kostet ein weisser Spritzer 1,70 Euro, ein Viertel von dem, was ich in Zürich bezahle, und es wundert mich gar nicht, dass einige der Gäste schon um 18 Uhr schräg stehen. Der Wirt bringt mir Soletti. Hier gibt es keine grünen Nüsse, hier gibt es noch Salzstangen. Hinter mir an der Bar redet ein Mann auf die Frau ein, an der er sich festhält, liebestrunken, denke ich, ohne hören zu können, was er sagt. Wieder in einer Sprache, die so weit von der mir vertrauten abweicht, dass ich den Gesprächen nicht einfach durch alle Nebengeräusche folgen kann. Als die Männer am Nebentisch beginnen, über die Ukraine und die EU zu sprechen, habe ich den plötzlichen Impuls, die Brille aufzusetzen, um sie besser zu verstehen. Es hilft aber nur wenig.
0505
Hier also endlich die Strophe, in der das Wort vorkommt. Radikal. Gefolgt vom Konjunktiv.
heimat. verbunden. mit erde.
der garten vielleicht. eher
schon der planet.
weltbürgerin. ohne die welt
zu kennen. die heimat
begrenzt durch den
horizont. durch die sprache.
natürlich die sprache.
und die geistige
heimat schliesslich der kopf.
aber die wurzeln. aus etwas
herausgewachsen zu sein.
aufgewachsen. wie radikal
müsste man sein. um sich
zu entwurzeln. heimatlos
würde ich nicht zu mir sagen.
zuhause. das ist das
wort. oder: bei uns.
heimat. verbunden. mit liebe.
mit dir. dich. meine ich.
deine stimme. der tonfall
mit dem du hallo
sagst. dich meine ich. wie du
mich anrufst. ansiehst.
dich anvertraust. wo will ich
leben. wen will ich
sehen. täglich. wöchentlich.
einmal im monat. mindestens
dreimal im jahr. dich meine ich.
und wenn sie nicht
gestorben. und wenn sie
gestorben. immer auch
euch. jeden und jede
von euch.
es gibt nicht das recht auf
heimat. auf liebe ja auch nicht.
Angst vor grossen Worten? Nein, die will man sich auch in der Titeltextabteilung des onrail-Magazins nicht nachsagen lassen müssen.
0504
Koffer packen. Sicherung starten. Briefwählen. Ticket ausdrucken. Ladegerät suchen. Strophen 3 und 4 an Jürgen schicken.
heimat. verbunden. mit schutz.
rechtsaussen. oder dagegen.
gibt keinen schutz für
die wörter. die sind frei
wie die kameradschaften.
über die der verfassungsschutz
wacht. nur die schweiz hegt
und pflegt ihre denkmäler so.
was wir für wichtig
erachten. erhaltenswert. was wir
bewahren. ist heimatschutzsache.
in der schweiz
heisst das so. kann das so
heissen. wie auch heimatkunde.
in manchen kantonen noch
pflichtfach.
keine heimat mehr. das singt
herbert. und meint einen makel.
heimat. vorgestellt: wahl.
wien erst einmal. das zerrissene.
im rechtsruck gelandet. erwachen
des widerstands. warum zuhause
nicht aufgestanden? nicht vertrieben.
und auch nicht geflohen. einfach nur
weg. und es auswandern nennen.
auslandsdeutsche. dem land
den rücken gekehrt. für ein anderes
auf die strasse gegangen. stellvertreter-
empörung. was bedeutet es
immer da zu sein, wo die rechten
gewählt werden. jetzt ja
die schweiz. meine
wahlheimat.
dass das land keines wird, in dem
man nicht leben will. kann. darf.
0503
Ich habe gesucht, in meinem Ordner mit Texten: Es gibt nur drei Dokumente, in denen das Wort „radikal“ vorkommt. Eines ist eine zweite Fassung, eines ein Entwurf und eines ein Gedicht, das ich für die [SIC] zum Thema „Heimat“ geschrieben habe (apropos: grosse Worte). Ein Gedicht, in dem die Strecke vorkommt, die ich am Montag nehmen werde, um nach Krems zu gelangen. Um mal wieder woanders zu sein. Auch deshalb landet es in der Anstalt. Heute die ersten zwei Strophen:
heimat. niemals allein.
heimat. verbunden. mit film.
die ewig singenden wälder.
sie galten als sauer. und wir
als die unbekannte der gleichung.
generation erster golfkrieg.
die heide noch immer
so grün. seit 35 üben nun
truppen in bergen. bei belsen.
und der gutsbesitzer,
der heimat vertrieben,
wildert noch immer öffentlich-
rechtlich. mit ziemann
und prack. mit einschaltquoten
wie rühmann. sie hören das lied
der riesengebirgler.
heimat. ich würde gern home
sagen. nicht homeland.
heimat. verbunden. mit lied.
westerwald. o du schöner.
rhein. o du wunder. du
schöner und deutscher.
über alles du. bist doch
ein schweizer. gebürtig.
wirklich die hohen tannen.
wie grün deine blätter. o baum.
und erwachen. zwischen zürich
und wien. im zug eingeschlafen.
beim blick aus dem fenster
an deutschland denken.
deutscher wald denken. tatsächlich
ein deutsches netz haben. im korridor
sein. das andere deutsche
eck. das ohne kaiser.
beheimatet sein. beschattet
stell ich mir vor. also begleitet.
0502
Radikale Deeskalation
Sechseläuten, so heisst das Zürcher Frühlingsfest der Zünfte, erst gibt es einen Umzug, zum Abschluss umkreisen
Reiter den Scheiterhaufen, auf dem der Böögg
steht, ein Schneemann mit integriertem Sprengsatz. Jedes Jahr warten Zürcher_innen und Tourist_innen am Sechseläutenplatz, wartet die Schweiz am Fernsehen und Online-Ticker, dass es chlöpft. Dass der Böögg explodiert. Je früher desto besser – für den Sommer! (eine Wettervorhersage, die erstaunlich oft stimmt.)
1. Mai, so heisst der „Kampftag der Arbeiterbewegung“ auch in Zürich, erst gibt es einen Umzug (diesmal mit 14.000 Teilnehmer_innen), zum Abschluss kreist die Polizei das Langstrassenquartier
ein, wo sich am Helvetiaplatz der Schwarze Block für die Nachdemo bereit macht. Jedes Jahr wartet Zürich, warten die Medien, die Schaulustigen, wartet die Schweiz am Fernsehen und Online-Ticker,
dass es chlöpft. Dass Scheiben klirren, Farbbeutel und Steine fliegen. Je mehr, desto besser – für die Erzählung vom brisanten 1. Mai in Zürich.
Der Zürcher Stadtrat Richard Wolff von der Alternativen Liste, (auch gern mal in der Presse als radikale Linke bezeichnet) hat gestern
seinen ersten 1. Mai als Polizeivorsteher erlebt. Er, der den 1. Mai als „sein Sechseläuten“ bezeichnet und vom Schwarzen Block als «interessante Ergänzung» gesprochen hat, die zur
«Vielfalt und Buntheit der Meinungen» beitrage, hat im Vorfeld erklärt, dass eine Nachdemo nicht toleriert werde.
Gestern Morgen hab ich mir für den AL-Stadtrat, den ich gewählt hätte, wenn ich schon könnte, gewünscht, dass es einen friedlichen 1. Mai geben wird. Dass kein Gummischrot, kein
Wasserwerfer, kein Tränengas zum Einsatz kommt, dass es weder Verletzungen noch Verhaftungen gibt. Warum? Weil ich nicht wollte, dass „seine Polizei“ auf „seinen Schwarzen Block“ losgeht? Weil
ich sowieso gegen Gewalt bin, von allen Seiten?
Ich weiss es nicht, aber mein Wunsch hat sich erfüllt. Es war ruhig (wie schon in den ganzen letzten Jahren, aber die Erzählung vom brisanten Zürcher Maifeiertag hält sich offenbar auch bei mir).
Alle sind zufrieden. Die Stadt. Die Polizei. Die Presse. Einzig die NZZ bedauert den „grossen personellen Aufwand, den die Polizei leisten muss, um Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten“.
Und der Aufwand war in der Tat enorm, massives Polizeiaufgebot am Sechseläutenplatz und im Langstrassenquartier, ein Hubschrauber kreiste über der Stadt, die gut 200 radikal Linken, die dem
Aufruf des Revolutionären Bündnis zur unbewilligten antikapitalistischen Nachdemo gefolgt waren, wurden auf dem Helvetiaplatz eingekesselt, zogen sich zurück. „Zahm“, „frustriert“, „resigniert“
heisst es über sie in der NZZ, nachdem es nicht zu Ausschreitungen gekommen ist. „Friedlich“ könnte man auch sagen.
Aber der „Schwarze Block“ bekommt selten eine gute Presse. Da gehört das Zitat des AL-Polizeivorstehers schon zum positivsten, was ich bis jetzt gelesen habe.
0501
1. Tag in der Anstalt
„Nachher sagen zu können: Ich war in der Anstalt. (…) Deren Name für Verrücktsein steht. In der ganzen Stadt ein Synonym für das Herausfallen aus der Norm.“
(Aus: Hinter den Augen, Luftschacht Verlag, 2013)
Was ich hier/hier unter anderem tun will:
-
über Radikalität nachdenken
-
insbesondere in der Literatur
-
auch über die Möglichkeit radikalen Relativierens
-
ins Schreiben kommen
-
Pläne umwerfen
-
meine Maifreiheit beschützen
Und weil heute der 1. Mai und hier noch Zürich ist:

 klischeeanstalt.net
klischeeanstalt.net






